Präsentationsvideo für den neuen touristischen Rundgang durch die Johanneskirche
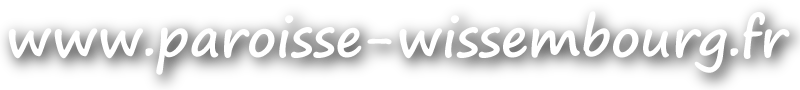
L A F R E S Q U E D E L A
F R E S K E N D E R R É C O N C I L I AT I O N
V E R S Ö H N U N G


Man betritt die Kirche durch den Haupteingang, um ins Hauptschiff zu kommen. Dieser Teil des Gebäudes wurde im 16. Jahrhundert neben einer älteren romanischen Konstruktion erbaut. Die Decke ist neu, sie wurde in Anleh-nung an die Decke der Sakristei aus dem 16. Jahrhundert wiederhergestellt.
Die zwei Seitentore sind interessant, sie sind durch gestreckte Säulchen begrenzt. Die auf der Südseite ist durch ein sehr schönes Eisengitter aus dem Jahr 1912 geschützt. Sie besaß ursprünglich einen bemerkenswerten Türklopfer, den man heute im Museum Westerkamp besichtigen kann. Man weiß nur wenig über das frühere Hauptschiff. Es wird behauptet, es habe aus drei Tonnen bestanden, dies wird aber nicht bestätigt, von den drei heute sichtbaren Bögen ist nur der mittlere romanisch. Erst im 16. Jahrhundert, nach einigen zusätzlichen Baumaßen, präsentierte sich das Gebäude wie heute.
Die Kapelle rechts hat zwei Spitzjochbögen, die sich zum Mittelschiff hin in zwei gebrochenen Bögen öffnen. Sie stammt aus dem 15. bis 16. Jahrhundert. Vielleicht handelt es sich hier um die Dreifaltigkeits-Kapelle, die 1513 gebaut wurde, die man aber eher auf der Nordseite vermutete und die in der Revolution von 1789 zerstört wurde. An der Wand der Kapelle befindet sich ein Medaillon mit dem Reformator Martin BUTZER.
Im Norden ist im 16. Jahrhundert ein Seitenschiff errichtet worden, wie dies das Datum 1513 anzeigt, das über dem Portal angebracht ist. Die beiden Jochbögen sind mit Netzbögen reich verziert, die im Kontrast stehen zu der allgemeinen Nüchternheit des Gebäudes. Die Bögen tragen an ihrem Schlussstein das Wappen der Schilling, einer reichen Familie aus Krakau, die aus Weißenburg stammte und die der Gemeinde das nördliche Seitenschiff schenkte. Dieser Teil des Gebäudes wurde im Zweiten Weltkrieg stark zerstört und gewissenhaft rekonstruiert.
Man erkennt auch typisch spätgotische Fenster mit "Fischblasen"-Motiven im oberen Bereich. Vor die Seitenwand wurde die Büste von Martin LUTHER angebracht, ein Denkmal, das von den protestantischen Bürgern von Weißenburg 1817 zur Erinnerung an 300 Jahre Reformation errichtet wurde.
Beim Chor befindet sich die Kanzel im Renaissance-Stil, die auch stark beschädigt wurde und ebenso wie der Sockel wiederhergestellt wurde.
Hinter der Kanzel erscheint auf der Turmwand eine kleine Wandmalerei aus dem 14. Jahrhundert, die aber leider ziemlich schlecht zu sehen ist und die 1960 renoviert wurde: Sie zeigt eine Frau im weißen Kleid mit einem roten Mantel, die die Hände zum Gebet erhebt.
Der Turm ist der älteste Teil des Gebäudes. Er stammt aus dem 13. Jahrhundert und erinnert an seine ältere Schwester von der Abtei St. Peter und Paul.
Über dem Triumphbogen befindet sich ein Türsturz, der aus einem früheren romanischen Gebäude stammt und geschmückt ist mit einem Lamm Gottes. Dies ist wohl das älteste Stück der Kirche, es könnte aus dem 8. Jahrhundert stammen.
Der Chorraum wurde mit Sicherheit kurz nach dem Turm erbaut. Er weist keinen einheitlichen Stil auf. Nach dem Architekt Steiner, der die Restaurierung im Jahr 1912 überwachte, war der romanische Chor zunächst umschlossen von einer halbrunden Apsis. Man kann feststel-len, dass die Spitzbögen des vorderen Chorraums auf romanischen Kapitellen aufliegen. Einer von ihnen stellt einen Kopf dar.
Der Chor bewahrt in seinem gotischen Teil die Reste eines Tabernakels, das wohl während der Revolution von 1789 abgeschlagen wurde. Im Hintergrund der Nische kann man eine Silhouette erraten, die vielleicht den auferstandenen Christus darstellen könnte. Der Chor öffnet sich zu zwei Seitenkapellen. Die erste ist eine Apsis mit fünf Feldern und wurde sicher später angebaut. Man findet dort auf dem Boden den Rest eines Kapitells mit stili-sierten Akanthusblättern, das bei den Restaurierungsarbeiten im Jahr 1958 unter den Platten des Hauptschiffs entdeckt wurde. Es könnte aus der früheren vorromanischen Kirche stammen.
Die zweite Seitenkapelle scheint zeit-gleich mit dem Chor entstanden zu sein. Sie ist mit schönen Blattkapitellen ver-ziert, die ihre Entsprechungen in den Sei-tenschiffen der Abtei St. Peter und Paul finden. Eine Öffnung, die wohl früher nach draußen führte, enthält das einzige Stück eines alten Kirchenfensters. Es ist wohl vom Beginn des 14. Jahrhunderts. Alle anderen Fenster der Kirche stammen aus dem Jahr 1985. Unter dem Bogen zum Mittelschiff findet sich das Taufbecken mit einer Wanne, die aus einem früheren Ge-bäude stammen könnte. Die Kapelle ist nach dem Heiligen Stanislas benannt, was auf die Reliquien des Heiligen zurückgeht, die von der Familie Schilling hinterlegt wurden. Diese Reliquien wurden sicher während der Reformation entfernt.
Nach einem Schriftstück aus dem Jahr 1725 soll König Stanislas während seines Aufenthalts in Weißenburg einen neuen Altar gestiftet haben, der seinem Heiligen gewidmet war.
Auf der anderen Seite des Chors öffnet sich eine Tür zur Sakristei mit einer getäfelten Decke und Wänden, die teilweise von Wandma-lereien bedeckt sind. Das Erdgeschoss hat wohl immer als Sakristei gedient, die erste Etage lässt aber eher an eine Kapelle denken, weil man dort Weihekreuze findet.
Die Wandmalereien
Sie stammen wohl aus dem 14. Jahrhundert und sind 1990 restauriert worden.
Im Erdgeschoss, unter der Decke der Sakristei befindet sich ein gemauerter Sockel, der vielleicht ursprünglich einen steinernen Altar trug, der sich im ersten Stock befand. Auf dem Sockel ist der gekreuzigte Christus dargestellt, der von vier En-geln umgeben ist, die das Blut auffangen, das aus seinen Wunden fließt.
Im ersten Stock befinden sich über der Treppe zwei Fresken, die den heiligen Erasmus darstellen, dem Erzbischof von Formia, der 303 den Märtyrertod starb. Rechts steht er, segnend mit einem Buch in der Hand. Er befindet sich unter einem gotischen Baldachin. Zu seinen Füßen erkennt man rechts eine kniende Frau und ein liegendes Kind und links eine kleine kauernde Figur.
Links erlebt der Erzbischof eine grauenhafte Folter: er liegt mit seiner Mitra auf dem Boden, während zwei Folterer seine Gedärme auf einer Winde aufrollen.
Auf der Wand rechts davon findet sich eine große rechteckige Tafel, die sechs Felder mit sitzenden Figuren zeigt. In dem ersten Feld unter der Decke segnet (oder krönt) Christus Maria, die auf einem Thron sitzt und von vier Engeln umgeben ist. In dem zweiten Feld ist die Jungfrau im Mittelpunkt mit Christus, der die Weltkugel in seinen Händen hält. Links sind drei Engel, die die Erzengel sein könnten, rechts sieht man die vier Evangelisten mit Flügeln (Matthäus mit dem Adlerkopf, Johannes mit dem Engelskopf, Markus mit dem Löwenkopf und Lukas mit dem Stierkopf). Dann kommt eine Reihe von dreizehn Personen, Heilige oder Apostel. Das folgende Feld besteht aus zehn Heiligen, die die Palme der Märtyrer tragen. Im vorletzten Feld sehen wir im Mittelpunkt eine Kreuzigung und drei Personen auf jeder Seite. Im letzten Feld errät man zehn Silhouetten und Reste von Inschriften.
Wenden wir uns nun den letzten beiden Wandmalereien zu: Die Heilige Katharina und die Jungfrau mit dem Einhorn. Nach der Legende ist das Einhorn Symbol von Kraft und Energie. Im Mittelalter glaubte man fest an seine Existenz. In der Spätgotik erscheint er oft in Szenen der Verkündigung. Hier legt das Einhorn seinen Kopf auf die Knie der Jungfrau.
An den Mauern befinden sich Weihekreuze. Man kann auch ein sehr altes Schloss an der Tür finden, die in den früheren Archivraum führte, der während der Bombardierung 1945 zerstört wurde.
Wenn man die Sakristei verlässt, wendet man sich wieder dem Mittelschiff zu.
Die grosse Orgel im Hintergrund der Kirche wurde von 2014 bis 2015 von dem Orgelbauer Dominique Thomas gebaut und ersetzte die früheren Instrumente von Ernest Mühleisen (1961) und Andreas Silbermann (1720, das während des Zweiten Weltkriegs zerstört wurde).
Nach dem Verlassen kann man nach rechts abbiegen und auf die Wallanlagen steigen, um die Gesamtanlage der Kirche St. Johann zu bewundern mit einem Dach, das im Vergleich zum Rest des Gebäudes fast überdimensioniert ist. Der Dachstuhl aus massiver Eiche ist beeindruckend.



Im Elsass – wie in anderen Pro-vinzen des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation verbreitete sich die Lehre Luthers, die sich auf das "reine Evangelium" stützte, sehr schnell, vor allem in der Bürgerschaft der freien Reichsstädte.
Die Weißenburger befanden sich ja seit langen Jahren im Konflikt mit der Abtei. Die Äbte ernannten die Priester für die Gemeinden, die oft kaum gebildet waren.
Das war nicht der Fall von Heinrich MOTHERER an der Kirche St. Johann, ein aufgeklärter Mann, dem es nach einem Prozess gelang, die Pfarrkirche freizukaufen und sie unabhängig zu machen.
Er erklärte sich öffentlich für die Reformation und heiratete 1522 Anna Jacob aus GERMERSHEIM.
Weil er das Volk in den Grundlagen der evangelischen Lehre unterrichten wollte, wandte er sich an Martin butzer aus Schlettstadt, der bei Franz von Sickingen Prediger war und der für seinen Eifer und seine gute Kenntnis der Heiligen Schrift bekannt war. Butzer kam im November 1522 nach Weißenburg. Seit dem Beginn seiner kurzen Amtszeit war er im Konflikt mit den Mönchen. Butzer lud seine Gegner zu einer öf-fentlichen Disputation ein, aber sie kamen nicht.
Butzer legte großen Wert auf die Volksaufklärung: Jeden Tag stieg er auf die Kanzel und an Feiertagen sogar zwei Mal. Nach dem Tod seines Beschützers Sickingen musste Butzer aus Weißenburg fliehen und fand Mitte Mai 1523 Aufnahme in Straßburg.
Das pädagogische Wirken von Butzer in Weißenburg ist dank eines Bandes von Johann Schott im Jahr 1523 bekannt (Martin Bucer, an ein Christlichen Rath und Gemeyn der Statt Weissenburg. Summary seiner Predigt)
Butzer betont unter anderem, dass Christus, unser einziger Herr, seinen Jüngern befohlen hat, alle Nationen zu belehren und ihnen all das beizubringen, was er ihnen verkündigt hat (Math. 28). Er erinnert auch daran, dass der Kern der Glauben an Gott und die Nächstenliebe ist und nicht irgendwelche über-holten Angelegenheiten (Johannes 6 und 15).
MARTIN BUTZER und die Reformation in Weißenburg



Die Kirchenfenster, das Kreuz und die zwei Leuchter der Kirche St. Johann wurden von dem Bildhauer Gérard LARDEUR (1931-2002) entworfen, Sohn eines Glasbläsers der ihn für die Probleme der Transparenz empfänglich machte. Nach seinem Kunstgewerbestudium und einer Zeit an der Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts in Paris interessierte er sich für die Skulptur.
Sein Lieblingsmaterial wurde das Metall. Die Kirche St. Johann besitzt eines seiner Hauptwerke, das Kreuz und die Leuchter in Inox.
Dieses Ensemble wurde im Jahr 1985 hergestellt und eingesetzt. Das Kreuz trägt keinen Körper. Ein aufmerksamer Besucher wird erkennen, dass dieser Körper angedeutet ist, ohne ihn wirklich direkt zu zeigen. Die Arme des Kreuzes sind leicht nach vorne gewölbt wie wenn sie so den Besucher umarmen wollten. Dies stellt die Liebe Gottes für die Menschen dar. Diese Liebe überwindet alle Individualitäten.
Gérard Lardeur sagte: "In unserer heutigen Welt ist der Mensch mehr als Individuum, er ist Mensch." Der Humanismus und die Liebe sind durch dieses Werk aus-gedrückt.
Die Kirchenfenster sind abstrakt - wie alle Kirchenfenster von Gérard Lardeur. Das Licht ist so gefiltert, dass die Helligkeit der Kirche erhalten bleibt. In den Fenstern des Haupteingangs erscheint keine Farbe. Das Spiel der Farben ist mit Sachkenntnisdosiert, je nachdem, wo der Besucher der Kirche sich befindet. In der Regel ist die Farbpalette pastellfarben, bis auf zwei kleine Fenster in der Stanislas-Kapelle mit sehr kräftigen Farben. Der Künstler hat in seiner Konzeption den Akzent nicht auf die Farbe legen wollen, sondern auf den Ausschnitt. "Meine Fenster sind rein geometrisch", sagte er. Die wichtigste geometrische Form ist der Kreis. Da das Augenmerk auf den Ausschnitt gelegt wird, erscheint die Bedeutung der Linie, die unterstrichen wird durch verschieden Längen und Breiten des Bleis. In den Fenstern sind die Linien oder die Schrift wichtiger als die Farbe und das Bild. Das ist ein sehr protestantisches Konzept. Gérard Lardeur drückt es folgendermaßen aus : "Das Licht bestimmt das Wort, verfeinert die Wahrnehmung und wird durch sein willenhaftes Eindringen ständige Entspannung oder wird vielmehr Werkzeug einer Entspannung. Ich ziehe den Kreis, perfekte Form, Bild des Beginns und des Endes, das gleich und gleich verbindet. Der Kreis ist Eins und Alles. Der Mensch im Übergangsstadium ist ein durch eine Horizontale getrennter Kreis, in seinem Zentrum zerschnitten. Ich befinde mich mit drei Elementen: zwei Halbkreisen und einem Raum. Das ist das Bild des Menschen, der seit dem Ursprung in Geist und Materie getrennt wurde oder wie es andere ausdrücken in göttliche und tierische Natur. Die Vollendung ist die Eroberung des einen durch das andere."
Durch seine Werke in der Kirche St. Johann bezieht sich Gérard Lardeur auf die Sehnsucht jedes Menschen nach der Überwindung seiner menschlichen Natur durch die Suche nach dem Göttlichen. Dies ist nur möglich durch die Liebe, die ihm Gott in Jesus Christus bezeugt, dessen Gegenwart durch das Licht in den Leuchtern angedeutet wird.
Die Kirchenfenster, Leuchter und Kreuz von
Gérard Lardeur

enn man den Hof hinter dem nördli-chen Seitenschiff betritt, so sieht man an der Mauer zum Pfarrgarten 17 aufgestellte Grabsteine. Die ältesten stammen aus dem zweiten Viertel des 15. Jahrhunderts und die jüngsten vom Ende des 18. Jahrhunderts.
Einige Steine gehören zur Kirche St. Johann bzw. zur Kirche St. Michael (sie befand im Bruch und wurde wäh-rend der Revolution zerstört). Einige Familien oder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens konnten das Privileg haben im Bereich der Kirche beer-digt zu werden.
Die Platten 8, 9 und 11 betreffen Geistliche. Das sind der Priester Nicolaus METZER der 1451 gestorben sein soll, der Pfarrer Michael GAMBS der im März 1775 auf dem Friedhof St. Michael beerdigt wurde und dessen Grabstein 1892 in der Nähe der Post gefunden wurde (so A. SCHAAF). Der Pfarrer Johannes HUBER wiederum war Pfarrer in Kandel und ist 1635 gestorben.
Die anderen Platten sind von Mitgliedern alter Patrizier-Familien aus Weißenburg.
So gehören die zwei ersten Platten aus dem ersten Viertel des 17. Jahrhunderts Johann Bernhart von BOTZHEIM (+ 25.12.1609) und seiner Frau Margare-tha PRECHTER (+ 02.08.1614). Johann Bernhart von BOTZHEIM, dessen Familie aus der Nähe von Schlett-stadt kommt, war Berater beim pfälzischen Kurfürsten und Ober-amtmann von KREUZNACH.
Ein anderes Beispiel ist der Grabstein Nummer 7: Heinrich HÜTER (+ 1538), der als "Hausgenosse" erwähnt wird, war in zweiter Ehe mit Demuth SCHILLING verheiratet und wohl der Familie WALSPRONN oder WALSBRONN aus Weißenburg verbunden, die eine Stiftung gründeten, die fast fünf Jahrhunderte fortdauerte.
DIE GRABSTEINE der Kirche Sankt Johann



DIE KIRCHE SANKT JOHANN

Christus von Wissembourg (zirka 1060)
Altes Kirchenfenster der Abtei Saints-Pierre-et-Paul von Wissembourg. Das älteste erhaltene figurative Kirchenfenster der Welt. Strasbourg, Musée de l'OEuvre Notre-Dame

Weißenburg war zunächst (um 650) und für mehrere Jahrhunderte ein wichtiges Kloster, das auf der Lauterinsel am Fuße der Nordvogesen erbaut wurde.
Zwischen dem 8. und dem 11. Jahrhundert kamen nicht wenige Äbte aus Weißenburg auf den Bischoffsitz in Speyer. Es war auch nicht selten, dass ein Erzbischof von Worms, Mainz oder Basel gleichzeitig an der Spitze des Klosters von Weißenburg stand. Erinnert sei daran, dass Weißenburg bis 1790 zur Diözese von Speyer gehört hat und erst 1803 der Diözese von Straßburg zugeordnet wurde.
Die Klosterschule oder das Scriptorium des Klosters sind vor allem deshalb bekannt, weil sie im 9. Jahrhundert von dem Mönch Otfried geleitet wurden, dem Verfasser des bekannten "Evangelienbuches" in althochdeutscher Sprache.
1179 wurde Weißenburg zum ersten Mal als befestigter Ort, also als "Stadt" erwähnt. Sie befreite sich nach und nach aus der Herrschaft der Äbte und wurde dann "freie Reichsstadt, die allein dem Vertreter des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation Unterwerfung und Tribut schuldet".
Weißenburg ist Mitglied des Zehnstädte-Bundes (Dekapolis), eines Bundes, der zehn Kaiserstädte seit dem Jahr 1354 verbündet und sich zwischen dem 13. und dem 16. Jahrhundert zu der beeindruckenden Pracht entwickelt, die man auf den Stichen von Hogenberg oder Merian im 16. und 17. Jahrhundert bewundern kann. Von dieser Größe zeugen heute noch die Abteikirche St. Peter und Paul, die Kirche St. Johann und die Dominikanerkirche, die heute in das Kulturzentrum integriert ist.
Nach den Bauernkriegen (1525) bekennt sich Weißenburg zur Reformation (1534) und erlebt im 16. Jahrhundert bis zum Dreißigjährigen Krieg einen gewissen Wohlstand, der vor allem auf dem Handel mit Wein, Leinen und Kastanien aufbaut.
In Folge der Herausforderungen des Dreißigjährigen Krieges geht Weißenburg wie andere Städte und Gebietschaften im Elsass nach und nach in den französischen Herrschaftsbereich über. Während des Pfälzischen Erbfolgekrieges (1672-1679) unter Ludwig dem XIV. entscheidet sich der Colonel Labrosse dazu, die Stadt zu zerstören: außer einem Teil der Stadt fallen vor allem das Rathaus und die Archive den Flammen zum Opfer.
Am 4 August 1870 findet auf dem Geisberg nahe Weißenburg die erste Schlacht und Niederlage der Franzosen im deutsch-französischen Krieg von 1870/1871 statt.
Am Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt Weißenburg zu Beginn des Jahres 1945 mit den Kämpfen der letzten deutschen Offensive (Operation Nordwind) noch einmal eine große Zerstörung: die Kirche St. Johann wird schwer beschädigt.
Nach 1945 eröffnen die deutsch-französische Versöhnung und der Aufbau eines geeinten Europas – wie auch in anderen Ortschaften und Regionen an der Grenze – neue Perspektiven, in Frieden und Wohlstand zu leben.
WISSEMBOURG: Geschichtlicher Hintergrund







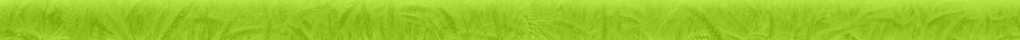
Création & développement : JLEVATIC




Paroisse Protestante Saint-Jean - 13 rue du Presbytère - 67160 Wissembourg